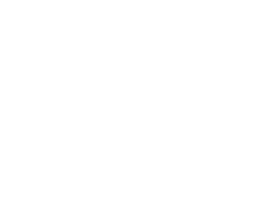Es muss schon viel passieren, damit der Autor dieser Website seinen windgeschützen Beobachterposten verlässt, auf den Marktplatz der Meinungen tritt und eine unbebilderte, zornige Rede veröffentlicht. Auslöser des Zorns waren eigentlich ein Artikel und ein Kommentar im Weser-Kurier vom 3.3.2015. Im Artikel wurde die frohe Botschaft verkündet, dass das Bremer u-Institut nun ''Träger des bundesweiten Kompetenzzentrums der Kultur- und Kreativwirtschaft'' geworden ist. Wenn man dem Artikel glauben will, dann hat sich das Institut zum Ziel gesetzt, der sogenannten Kultur- und Kreativbranche ''ein Gesicht zu geben''. Was auch immer das heißen mag. Klarer ist da schon die erklärte Absicht, ''vor Ort zu beraten und aus Künstlern unternehmerisch denkende Kreative zu mache.'' Und schließlich fehlt auch der inzwischen wohl allgegenwärtige Vernetzungsgedanke nicht, denn die InstitutsmitarbeiterInnen ''wollen die Innovationen der Kreativwirtschaft für andere Branchen nutzbar machen.'' Bremen, so ein Mitglied des Institutsvorstandes, ''sei Vorreiter in der Kultur und Kreativwirtschaft.'' Es gebe ''keinen Ort auf der Welt, wo wir lieber hinwollten mit unserem Institut.''
So gesehen ist Erfolg des u-Institutes, wie die Kommentatorin des Weser-Kuriers anmerkt, ''gerechter Lohn'' für Politik im Lande Bremen: Die Stadt bekommt das Institut, das sie schon seit langem verdient. Eigentlich schon mindestens seit dem frühen 18. Jahrhundert. In Leizpig wirkte in jener Zeit Bach, auch in Weimar, dem Städtchen, in dem etliche Jahrzehnte später Goethe und Schiller arbeiteten. Sie zogen ungezählte gebildete und schöpferische Frauen und Männer in den Ort.
Über die Zustände in Bremen zur selben Zeit schreibt der verstorbene Nestor der Bremischen Geschichtsschreibung, Herbert Schwarzwälder: ''Die geistige Bildung ging immer noch an der Mittel- und Unterschicht vorbei (...). Auch in der Oberschicht beschränkte sich das Interesse oft auf das für den Beruf Nützliche und allenfalls auf (...) christliche Erbauungsliteratur. 'Belesene' Ratsherren waren die Ausnahme.''
Was hat sich geändert seitdem? Klar, die Mittel- und Unterschicht hat jetzt prinzipiell die Möglichkeit, geistige Bildung zu erwerben. Aber real ist Bremen immer noch ein zertifiziertes Bildungsnotstandsland. Dass Bildung und Kultur vor allem das wirtschaftlich Nützliche zu sein habe, wird von den ökonomisch und politisch Dominierenden immer noch als selbstverständlich angesehen. Kaum ein öffentliches Wort über Kultur wird in Bremen gesprochen, ohne dass Kultur und Kreativität mit dem Wort 'Wirtschaft' und 'Standortfaktor' verbunden wird.
Im schlimmsten Falle verkommt bildende Kunst zur bunten Bilderwelt-Bespaßung, die auf die Mauern der Handelskammer projiziert wird. Der Muff des pfeffersäckischen Rentabilitätsdenkens hat über die Jahrhunderte die kleine Welt künstlerischen Denkens und Schaffens in Bremen so durchdringend parfümiert, dass kaum eine/r der Großen, die Bremen hervorgebracht hat, den Geruch ertragen hat und geblieben ist.
Und heute? Der Kultursenator Böhrnsen ist sicher eine Identifikationsfigur für den sozialdemokratischen Traum vom Aufstieg aus einfachen Verhältnissen. Aber er irritiert auch niemanden, indem er übertriebene Weltläufigkeit demonstriert. Man kann es ihm als Weisheit anrechnen, dass er seine Arbeit weitgehend an eine Staatsrätin abgegeben hat, die als gerechte Zuchtmeisterin über die Verteilung der schmalen Mittel wacht.
|
|
Wie groß aber wäre wohl das Geschrei, wenn sein Kollege Günthner die Leitung des Wirtschaftsressorts an eine Staatsrätin delegieren würde. Man muss also nur die Perspektive drehen, um zu erkennen: Wertschätzung der Kulturschaffenden dieser Stadt sieht anders aus.
Und jetzt das u-Institut! Es will im Zeitalter der Vermarktung von allem und jedem, die Künstlerschaft in Bremen und anderswo an das Netzwerken, die moderne Form des Filzes, und an unternehmerisches Denken heranführen. Solche Bestrebungen werden im Haushaltsnotlagenland sicher gerne gesehen. Bald wird es der Künstlerschaft noch lauter als bisher entgegenschallen: ''Lernt Euch besser zu verkaufen, damit ihr mehr einnehmt und dem Staat nicht auf der Tasche liegt.''
Also, was tun gegen die Vernützlichung der Kultur? Statt sich Meetings und Netzwerken anzuschließen, kann man kleine Zellen bilden oder sogar, Gott bewahre, alleine arbeiten. So bleibt man, fern von der Gerüchteküche des Filzes, unberechenbar. Wenn man es irgendwie kann, halte man sich fern von irgendwelcher ''Förderung'', die die Unabhängigkeit einschränkt. Wenn man es kann, halte man sich eher fern von der Kulturbehörde, von der Hollweg-Stiftung, die schon fast mächtiger ist als der Senator, von den Banken (welcher Banker will außer Profit noch frischen Wind?), von den wirtschaftlich Mächtigen und vom u-Institut. Man suche zum Beispiel die Nähe und Unterstützung der kleineren Kaufleute, des unruhigen Völkchens der Musiker, der Orchester und aller Theater, die ohne Weltoffenheit gar nicht arbeiten können. Eine Empfehlung, die der Warnung vor dem Pfeffersäckischen widerspricht. Nein! Die kleinen Kaufleute etwa sind nahe dran am Stadtleben. Es gibt viele Weltoffene, Gebildete und Belesene unter ihnen.
Was wäre zum Beispiel, wenn die vielleicht drei Dutzend Bremischen BuchhändlerInnen ein Jahr lang jeder monatlich zwei, drei Dutzend Euro in einen Topf würfen und versuchten, Nora Bossong in ihre Heimatstadt zu holen? Alle hätten in diesem Jahr einmal einen 'Stargast' zu einer Lesung in ihrem Laden. Die dankbaren Literaturinteressierten kämen in Scharen. Und am Ende des Jahres erschiene vielleicht ein Buch über Bremen, in dem der Gast die erfahrerene Gastfreundschaft rühmen, die Freuden und Leiden des 'Provinzlebens' schildern und endlich vielleicht auch die Furcht, ja richtig gelesen 'Furcht', der Stadtoberen und der Provinzliteraten vor dem Ende der miefigen, kulturellen Mittelmäßigkeit spiegeln würde. Denn an dieser Miefigkeit ist auch ein solch verlogenes Projekt wie der Stadtmusikantenpreis gescheitert. Welcher Künstler, welche Künstlerin läßt sich denn als Botschafter für eine Stadt einspannen, in der er oder sie zwar einmal erfolgreich gearbeitet hat, aber der er oder sie dann doch aus guten Gründen wieder den Rücken gekehrt hat.
Man muss die Künstlerinnen und Künstler demütig empfangen wie die Braut oder den Bräutigam. Man muss ihnen Geschenke zu Füssen legen (und keine undotierten Stadtmusikanten-Preise). Man muss sich ihnen weltoffen, geistreich, interessiert und großzügig präsentieren. Die Hoffnung auf den Messias? Eher ein Versuch zu überlegen, welche Möglichkeiten es geben könnte, nach tausend Jahren Miefigkeit die Tür aufzumachen und frischen Wind hereinzulassen. Bitte!
|